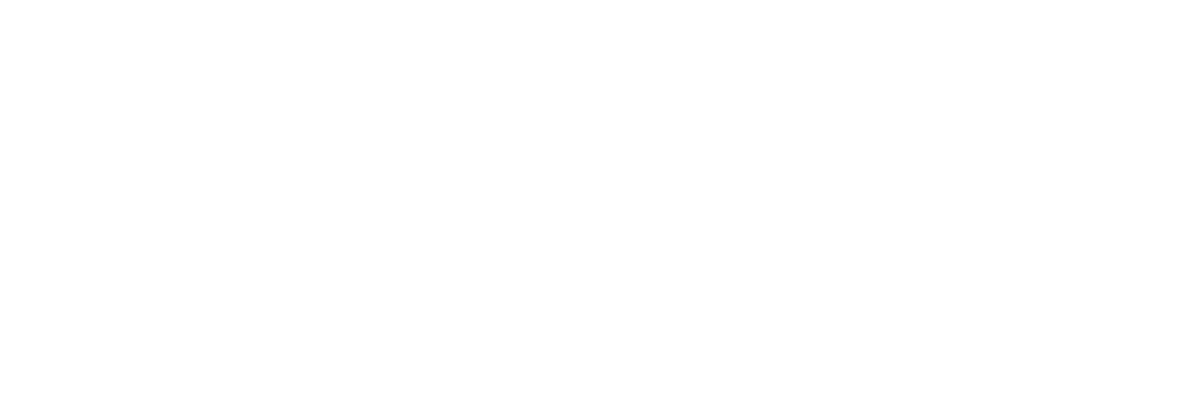Inhaltsverzeichnis
Der Fachkräftemangel in der IT spitzt sich zu. 2018 gab es laut einer Bitkom-Pressemitteilung 82.000 offene Stellen für IT-Spezialisten. 2019 meldete der Verband bereits 124.000 Stellen, ein Anstieg von 51 Prozent. 83 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, keine IT-Experten auf dem Arbeitsmarkt finden zu können. Die Zahlen für 2020 sind noch nicht veröffentlicht. 2019 erwarteten jedoch 65 Prozent der Umfrageteilnehmer, dass sich die Situation weiter verschärfen wird.
Besonders begehrt sind Software-Entwickler. In beiden Jahren gab etwa jedes dritte Unternehmen (29 Prozent 2018 bzw. 32 Prozent 2019) an, in diesem Bereich Verstärkung zu suchen. Misserfolge bei der Personalsuche waren häufig das Resultat hoher Gehaltsforderungen oder fehlender Qualifikationen auf Bewerberseite. Offensichtlich gibt es zu wenige erfahrene Software-Entwickler, um die steigende Nachfrage der Digitalisierung zu befriedigen. Hochqualifizierte Fachkräfte können sich ihren Arbeitgeber praktisch aussuchen und haben entsprechend hohe Gehaltsvorstellungen.
Diese Lücke zwischen Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt wird von Jahr zu Jahr größer, denn die Anforderungen an IT-Fachkräfte sind vielfältig und das Einsatzgebiet wächst rasant.
Kenntnisse über Trendtechnologien wie künstliche Intelligenz, Machine Learning, Robotic Process Automation, Cloud Computing und Cyber-Security sind hier nur die Spitze des Eisbergs. IT-Spezialisten sollten sich darüber hinaus im Minenfeld gesetzlicher Rahmenbedingungen zurechtfinden (bedingt beispielsweise durch die DSGVO oder den Wegfall der EU-US Privacy Shield Absprache) und Soft-Skills wie Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit, Selbstorganisation oder ein agiles Mindset vorweisen. Dazu müssen sie sich in der organisch gewachsenen IT-Landschaft zurechtfinden, die in vielen Unternehmen gang und gäbe ist.
Es liegt auf der Hand, dass solche hochqualifizierten Kandidaten nur einen kleinen Teil des Arbeitsmarkts ausmachen. Das führt zu einem Misfit zwischen Angebot und Nachfrage. In Zukunft ist es durchaus möglich, dass sich Arbeitgeber bei stellensuchenden IT-Fachkräften bewerben und nicht umgekehrt. Kleine und mittelständische Unternehmen bleiben dann häufig auf der Strecke.
Was bedeutet diese Entwicklung für die Digitalisierung?
Ein Mangel an hochqualifizierten Software-Entwicklern kann die Digitalisierung in Unternehmen massiv verzögern. Externe Entwicklungspartner können zwar Unterstützung leisten, aber gerade in großen Organisationen ergibt es Sinn, Software-Wartung und -Pflege inhouse zu halten. Zudem haben externe Software-Unternehmen ebenfalls Probleme, erfahrene Mitarbeiter zu finden. Das Problem verschiebt sich lediglich.
In großen Digitalisierungsprojekten führt meist kein Weg an internen Entwicklungskapazitäten vorbei. Doch die eigene IT leidet unter dem Fachkräftemangel. Die wenigen vorhandenen Software-Entwickler sind oft damit beschäftigt, die bestehende Infrastruktur am Laufen zu halten. Ihre Zeit verbringen sie mit Anwender-Support, Fehleranalysen, Bug Fixing und Change Requests. Für eine Weiterentwicklung der IT fehlen die Kapazitäten. In so einer Situation stockt die Digitalisierung, denn sie erfordert Ressourcen, die nicht zur Verfügung stehen.
Welche Lösungsansätze gibt es?
In ihrem Bericht von 2019 geht die Bitkom auf Maßnahmen ein, die geeignet sind, dem Fachkräftemangel auf organisationaler und gesellschaftlicher Ebene zu begegnen. Diese reichen von zusätzlichen Recruitment-Kanälen (zum Beispiel Hochschulkooperationen oder Karrieremessen) über Anpassungen an den Inhalten des Informatik-Studiums bis hin zu politischen Maßnahmen, wie Änderungen am Arbeitsrecht, um qualifizierte Zuwanderung zu ermöglichen.
Das alles sind relevante Themen, die angegangen werden müssen, um die vakanten Stellen sinnvoll besetzen zu können. Aber betrachten wir das Problem mal von einer anderen Seite.
Business-Analysten, IT-Berater, IT-Projektmanager und Product Owner verbringen viel Zeit damit, sich in die Anforderungen ihrer Auftraggeber einzuarbeiten. Sie analysieren Prozesse, lernen die Infrastruktur kennen und interagieren mit Stakeholdern bzw. Anwendern. Diese Erkenntnisse tragen sie zusammen, erstellen daraus Lasten- und Pflichtenhefte, briefen Entwickler, schreiben Epics und User-Storys und tapezieren die Wände mit den modellierten BPMN-Charts.
Die Kollegen in der IT, die nicht programmieren, gehen den Weg von der Anforderungsanalyse bis hin zum fertigen Software-Produkt zu einem großen Teil mit. Nur den entscheidenden Schritt, die technische Implementierung, überlassen sie Software-Entwicklern. Warum nicht IT-Experten, die eher theoretisch unterwegs sind, die Möglichkeit geben, lauffähige Applikationen selbst zu gestalten? Dazu braucht es keine langwierigen Weiterbildungen. Low-Code und No-Code-Ansätze benötigen relativ wenig Programmierwissen und liefern brauchbare Ergebnisse.
Low-Code-Digitalisierungsplattformen wie Allisa sind hervorragende Werkzeuge für IT-Projektmanager, um ihre Aufgaben ganzheitlich zu gestalten und die Entwicklungsressourcen des Unternehmens zu schonen. Die Analyse und Modellierung von Geschäftsprozessen liegt meist ohnehin im Verantwortungsbereich dieser Kollegen. Ihre Arbeitsbelastung muss daher nicht unbedingt steigen. Im Gegenteil: Sie können ihre Ergebnisse selbst überprüfen und optimieren, ohne langwierige Kommunikationsschleifen und Change-Prozesse.
Machen Low-Code-Ansätze Entwickler obsolet?
Es ist wichtig, mit der korrekten Erwartungshaltung an die Einführung einer Low-Code-Plattform heranzugehen. Low-Code-Ansätze sind darauf ausgerichtet, Software-Programmierung zu vereinfachen und Anwender mit geringen technischen Fachkenntnissen zu unterstützen. Aktuell sind sie jedoch nicht in der Lage, klassische, textbasierte Entwicklungsumgebungen vollständig zu ersetzen.
Zum einen müssen Low-Code-Plattformen weiterentwickelt und gepflegt werden. Dafür ist ein Level an Backend-Programmierung notwendig, das Low-Code nicht erreicht. Zum anderen sind Low-Code-Entwicklungsumgebungen hinsichtlich ihres Funktionsumfangs eingeschränkter als textbasierte Sprachen. Ihr Fokus auf geringe Komplexität und vorgefertigte Elemente führt sie an ihre Grenzen, wenn eine Software an die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens angepasst werden muss. Für manche Dinge braucht es nach wie vor Software-Entwickler.
Software-Integration beginnt jedoch selten auf einer grünen Wiese. Meistens werden neue Applikationen in eine bestehende IT-Landschaft eingebettet. Low-Code-Plattformen wie Allisa können hier der Dreh- und Angelpunkt für die Prozesssteuerung sein. Sie können Schnittstellen von und zu anderen Anwendungen optimal anbinden und bieten somit die Möglichkeit, Datenflüsse zu steuern und Daten entsprechend anzureichern. Auch hierfür werden natürlich Entwickler benötigt.
Fazit
Low-Code-Plattformen sind ein Game Changer in der Software-Entwicklung. Zum einen reduzieren sie den Implementierungszeitraum, da ein großer Teil des Abstimmungsaufwands zwischen Projektmanagern, Business Analysten, Product Ownern und Entwicklern entfällt. In Projekten sprechen wir gerne von Speed Sprints, da ein erster Prototyp bereits stehen kann, bevor der Sprint vollständig aufgesetzt wurde. Zum anderen schonen Low-Code-Ansätze die IT-Ressourcen des Unternehmens, da die Kapazitäten interner Software-Entwickler keinen Flaschenhals mehr darstellen. Programmieraufgaben können stattdessen verteilt werden.
Mit Hilfe von Low-Code-Entwicklungsumgebungen können Unternehmen dem Fachkräftemangel auf effektive Weise begegnen. Statt händeringend nach erfahrenen Software-Entwicklern zu suchen, befähigen sie IT-Experten ohne Programmierkenntnisse dazu, Applikationen über eine vereinfachte, visuelle Benutzerumgebung selbst zu erstellen.
Es ist zwar relativ unwahrscheinlich, dass die Bitkom 2021 von 100.000 offenen Stellen für IT-Projektmanager und Umschulungsangeboten für Software-Entwickler berichtet. Low-Code ist jedoch ein guter Weg, die eigenen Prozesse schneller zu digitalisieren.