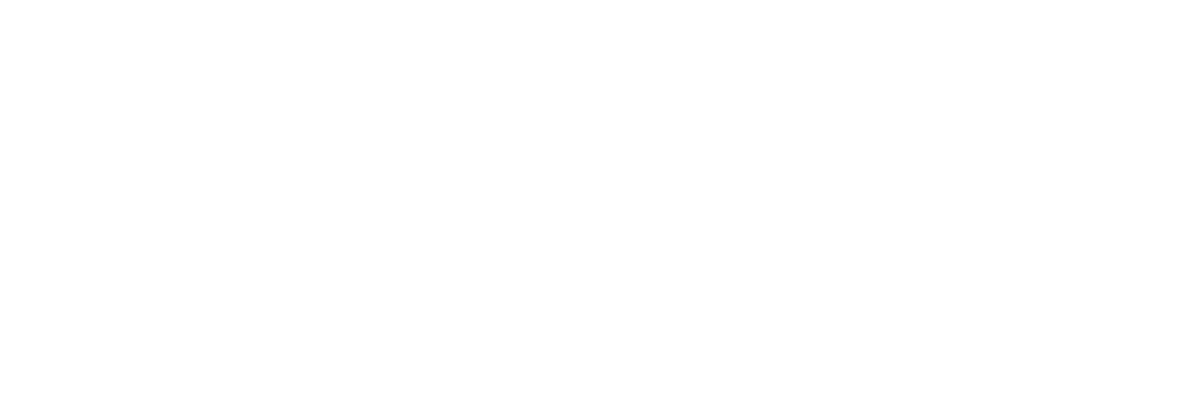Ab dem 28. Juni 2025 müssen die Webseiten in Deutschland barrierefrei sein. Das wird vom Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) verlangt und eine Untersuchung hat bisher ergeben, dass die Mehrheit von Webseiten nicht barrierefrei sind. Für Menschen mit Sehbehinderungen, motorischen Einschränkungen oder kognitiven Schwierigkeiten sind diese Webseiten nur schwer bis gar nicht zu nutzen.
Die Änderungen sind keine Option, sondern ist eine gesetzliche Pflicht und ab Ende Juni 2025 müssen mindestens die Kriterien der Barrierefreiheit des Levels AA eingehalten werden. Dieser Anforderungskatalog richtet sich nach dem WCAG („Web Content Accessibility Guidelines”) und der EU-Norm EN 301 549.
Nicht jedes Unternehmen muss den gesetzlichen Anforderungen nachkommen. Ausgenommen sind Kleinunternehmen mit weniger als 10 MitarbeiterInnen und/oder einem jährlichen Gesamtumsatz von max. 2 Millionen Euro. Private sowie rein geschäftliche (B2B) Angebote unterliegen nicht dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz.
Um die geforderten Stufen A und AA zu erfüllen, müssen folgende Prinzipien erfüllt werden:
- Wahrnehmbar: NutzerInnen müssen die Informationen und Elemente der Website wahrnehmen können.
- Bedienbar: Das Navigieren durch die Seite muss möglich und die Elemente müssen bedienbar sein.
- Verständlich: Infos und die Bedienung der Website müssen einfach zu verstehen sein.
- Robust: Inhalte müssen von mehreren Benutzeragenten einschließlich assistierender Techniken interpretiert werden können.
Das BIK (barrierefrei informieren und kommunizieren) bietet außerdem einen umfangreichen Katalog mit allen Prüfschritten, sowie einen Test für die eigene Webseite. Wenn alle Anforderungen erfüllt sind, erhält das Unternehmen eine Bestätigung, die auf der Webseite eingebunden werden kann.
Was passiert, wenn die Webseite nicht barrierefrei ist?
Wenn die Webseite die Kriterien nicht erfüllt, fordert dich die Marktüberwachungsbehörde auf, die Barrierefreiheit herzustellen. Wenn die Aufforderung nicht nachgekommen wird, kann die Behörde Bußgelder in Höhe von mehreren Tausend Euro verhängen.
Wie das genaue Bußgeld ist oder welche Strafen noch folgen können, ist bisher nicht festgelegt. Bei der Recherche gab es viele verschiedene Aussagen zu dem Thema. Dieser Text ist keine Rechtsberatung, sondern nur eine Zusammenstellung der aktuellen Informationen.
Auch wenn es noch ein Jahr dauert, bis das Gesetz in Kraft tritt, sollte mit den Anpassungen nicht bis zum letzten Moment gewartet werden. Verschiedene Seiten, wie z.B Wave Webaim, bieten den kostenlosen Service an, um die Barrierefreiheit auf der Webseite zu prüfen. Ein Screenreader kann ganz einfach als Add-On installiert werden, um sich die eigene Webseite vorlesen zu lassen.
Verschiedene Kernfunktionen lassen sich ganz einfach prüfen und ggf. anpassen. Das Thema wird in den nächsten Monaten nicht nachlassen und kann und sollte nicht ignoriert werden.